|
Beispiel Berlin:
Jüdische
Migration aus der ehemaligen Sowjetunion seit 1990
Von Judith Kessler
5. Auswirkungen der Zuwanderung auf
die Jüdische(n) Gemeinde(n)
In der
sozial-religiösen Tradition des Judentums entspricht die Aufnahme und
Unterstützung von Flüchtlingen der Erfüllung der
Mizwa
("Gebot") des
pidjon schewujim
("Errettung der
Gefangenen"), die in der 2000jährigen Diaspora existentielle Bedeutung
hatte. Dieser Aspekt, Troen nennt ihn "nationale jüdische Solidarität"
(1993, S.28), war einer der Gründe, die Aufnahme sowjetischer Juden in
Deutschland zu fordern. Dabei spielte eine nicht unwesentliche Rolle, daß
sich die Führung der zentralen jüdischen Institutionen in Deutschland bis
heute fast ausschließlich aus Überlebenden der Shoah rekrutiert, deren
Selbstverständnis durch diese Erfahrung wie durch die Werte ihrer Generation
geprägt ist. Ein zweiter Grund, die jüdische Zuwanderung (auch gegen den
Willen Israels) zu unterstützen, hing damit unmittelbar zusammen: die Angst
vor einem allmählichen Aussterben der durch die Shoah auf eine verschwindend
kleine Zahl "reduzierten" Juden in Deutschland.
Die Sorge um den
(formalen) Erhalt der jüdischen Gruppe ist mit der gesetzlichen Regelung,
mit dem massiven "Anrollen" der "Vierten Welle" nun vorläufig in den
Hintergrund geraten. Tatsächlich hat es nach dem Zweiten Weltkrieg keine
vergleichbar große und schnelle jüdische Zuwanderungsbewegung gegeben. Doch
kann es weder für die Jüdische(n) Gemeinde(n) als Institution, noch für ihre
Mitglieder folgenlos bleiben, daß die bisherige Majorität durch diese
"Welle" in kürzester Zeit, nach Mitgliederzahlen gemessen, zur Minorität
geworden ist. Die damit in quantitativer wie qualitativer Hinsicht
angesprochenen Veränderungen beginnen sich in beinahe allen Bereichen
allmählich herauszukristallisieren. Die folgenden Ausführungen beschränken
sich indes auf drei zentrale Aspekte: die Mitgliederstruktur der Jüdischen
Gemeinde(n), die soziale Arbeit (die neben und verknüpft mit einer
religiösen und einer kulturellen Funktion die Hauptaufgabe Jüdischer
Gemeinden darstellt) sowie die Aufnahmebereitschaft der Altmitglieder bzw.
die Partizipation der Neuzuwanderer.
5.1.
Veränderungen in der Mitgliederstruktur
Die ca. 60.000 bis
70.000 Juden in der Bundesrepublik machen weniger als 0,1 % der Bevölkerung
aus. Vor 1933 lebten über 600.000 Juden in Deutschland; Berlin hatte mit
173.000 Mitgliedern (4,3 % der Bevölkerung) die größte Gemeinde. Die
deutschen Juden (oder jüdischen Deutschen) vor 1933 unterschieden sich auch
in Berlin nicht wesentlich von der übrigen Bevölkerung: ein großer Teil war
so assimiliert und säkularisiert wie national orientiert - anders als die
Ostjuden aus Polen und Rußland, die häufig traditionell jüdisch lebten und
deren Berliner Geschichte mit dem armen "Scheunenviertel" ebenso verbunden
ist wie mit klangvollen Namen. Für 1921 verzeichnete ein Branchenbuch allein
48 russische Verlage in Berlin und der "Verband der russischen Juden in
Deutschland" zählt 1925 etwa 20.000 Flüchtlinge, von denen die meisten in
Berlin lebten (Burchard/Duwidowitsch 1994).
Gerade 8.000 Berliner
Juden erlebten das Jahr 1945, das Ende der Nazi-Diktatur und des
Massenmordens. Nach Kriegsende kamen vor allem ungarische,
tschechoslowakische und polnische Juden aus den KZs nach Berlin. Die
Massenauswanderung zwischen 1948 und 1952 in den gerade gegründeten Staat
Israel kostete fast die gesamte kulturelle und religiöse Substanz der
jüdischen Minderheit. Displaced persons und die kleine deutsch-jüdische
Restgruppe machten nun den Kern der Gemeinden aus. Sie blieben, obwohl ihnen
Deutschland erst nur Durchgangsstation sein sollte und setzten sich damit
dem Vorwurf von Juden in aller Welt und der Ächtung durch jüdische
Organisationen aus, die das "Land der Mörder" unter Bann stellten (vgl.
Kessler 1995). Die ursprünglichen "Abbruchgemeinden" veränderten sich seit
den 50er Jahren zu Einwanderergemeinden - durch Rückwanderer (aus Süd- und
Nordamerika, England, China z.B.) und neue Flüchtlinge. Politische
Konflikte, antisemitische Wellen und eine stalinistisch-antizionistische
Politik in Osteuropa zeitigten eine permanente, wenn auch zahlenmäßig kleine
Einwanderungsbewegung aus z.B. der DDR (1953), Ungarn (1956),
Tschechoslowakei (1968) und Polen (1968,1973). Daneben kam es häufig zu Ehen
mit nicht hier ansässigen Juden und infolgedessen zu Nachzügen aus dem
Ausland (vor allem Israel).
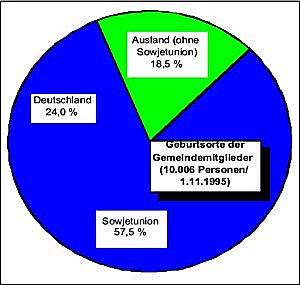 |
 |
Die auf die regionale
Herkunft bezogene Struktur der Gemeinden spiegelt sich in der oben stehenden
Abbildung wider (Berlin kann hier als typisch für die Altbundesländer
gelten) (109).
Die Auszählung nach
Geburtsorten in der Mitgliederdatei der Jüdischen Gemeinde zu Berlin ergibt,
daß von allen 10.006 Mitgliedern (1.11.1995) fast 76 % im Ausland geboren
sind (110).
Neben dem Umstand, daß
die nicht aus der Sowjetunion stammenden Juden ihre Mehrheit verloren haben
und mit 4.257 Personen zum Zeitpunkt der Erhebung noch 42,5 % der
Gemeindemitglieder ausmachen, zeigt die Graphik (unabhängig vom Zeitpunkt
des Zuzuges) über _ interregionale Zuwanderer. Die sehr unterschiedliche
geographische Herkunft der Mitglieder verweist daneben auf die Heterogenität
der jüdischen Gruppe in der Bundesrepublik und implizit auf differenzierte
kulturelle Kontexte, Mentalitäten, äußere Merkmale usw
(111).
Doch zurück zu einigen
quantitativen Fragen: Die o.g. Einwanderungswellen vor 1990 haben sich kaum
in einer Vergrößerung der Jüdischen Gemeinden niedergeschlagen, da
gleichzeitig eine starke Fluktuation ins Ausland und vielfach höhere
Sterberaten als Geburtenziffern bestanden
(112).
Die Mitgliederzahlen
stagnierten so von Mitte der 60er Jahre bis Ende der 80er Jahre fast, in
einigen Jahren waren sie sogar rückläufig. Erst die sowjetische Immigration
seit 1990 machte sich in einer steilen Zuwachsrate bemerkbar, wie die
Graphik auf der nächsten Seite zunächst für Gesamtdeutschland zeigt.
In Westdeutschland kam
es durch die Einwanderung zu mehreren Gemeindeneugründungen, z.B. in
Pforzheim und Oldenburg. Andere Kleingemeinden, die mit der Dimension der
Zuwanderung völlig überfordert waren bzw. sind, haben ihren Mitgliederstamm
vervielfacht, z.B. Baden-Baden, Kassel und Mülheim um das 7fache und Hof,
Hannover, Dortmund und Hagen um das 6fache. Verglichen mit den neuen
Bundesländern hatten die Altbundesländer jedoch bereits vor der sowjetischen
Einwanderung eine starke Mitgliederschaft. In der DDR und Ostberlin waren
bis zur Vereinigung insgesamt lediglich 250 bis 300 Juden in den Gemeinden
eingetragen.
Durch die
Länderquotierung für Kontingentflüchtlinge werden den neuen Bundesländern
seit 1991 ebenfalls Zuwanderer zugeteilt, die nun auch in Jüdische Gemeinden
eintreten.
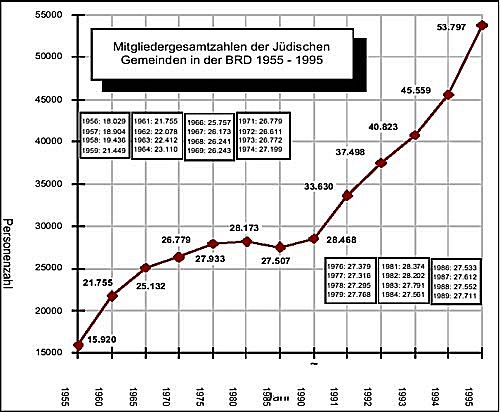
Die Gemeinde Potsdam
z.B. bestand 1989 aus einem Mitglied; sie wurde quasi durch die Zuwanderer
neu gegründet und hatte dann 1992 bereits 162 Mitglieder. Die Migrantenzahl
selbst ist in den neuen Bundesländern jedoch erheblich höher als die der
Gemeindemitglieder aus dem Zuwandererkreis (Ende 1995: 1.169 Personen)
(113).
Die Orte, in
die Migranten eingewiesen werden, haben häufig keinen Anschluß an die
Gemeinden und zum anderen ist der Anreiz, einer Gemeinde beizutreten,
geringer als in den "West-Gemeinden", die ihren Mitgliedern mehr soziale,
kulturelle und religiöse Angebote machen können. So leben derzeit nur 2,2 %
aller Mitglieder Jüdischer Gemeinden in den Neubundesländern. Für die neuen
Bundesländer insgesamt gilt, daß sie nach der Einreise wieder einer starken
Fluktuation unterliegen, die noch größer wäre, würde der Gesetzgeber die
Zuwanderer nicht an ihren Aufenthaltsort zu binden versuchen (vgl. 4.1.3).
In der folgenden
Abbildung des Mitgliederzuwachses der Berliner Gemeinde sind diese
Bundeslandwechsler jedoch nicht berücksichtigt; es werden in der Relation
zum Gesamtmitgliederzuwachs nur die Direktzuzüge abgebildet (Berlin als
erster Wohnort nach der Ausreise aus der früheren UdSSR).
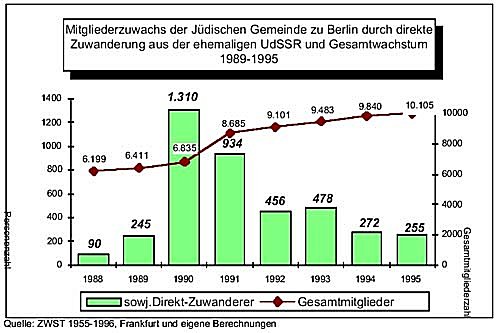
Selbst unter Ausschluß
der Personen aus der Sowjetunion, die über andere Bundesländer (vgl. 4.1.3)
oder Drittländer (z.B. Israel) nach Berlin zugezogen sind, zeigt sich, daß
das Mitgliederwachstum der Gemeinde auch in Berlin zum größten Teil den
sowjetischen Migranten zu verdanken ist, wobei der Hauptteil von ihnen im
Jahr 1990 und Anfang 1991 - also vor Inkrafttreten des geregelten Verfahrens
- eingereist ist (und zum großen Teil erst 1991 Mitglied der Gemeinde
geworden ist). Aufgrund der Quotenüberfüllung durch diese "Altfälle"
erfolgte später ein Zuzugsstop nach Berlin; daher zeigt sich die Situation
in den anderen Bundesländern genau umgekehrt. Dort sind die
Zuwanderungszahlen erst seit Mitte 1991 im Zuge der offiziellen
Quotenverteilung stärker gestiegen.
Exemplarisch für alle
Gemeinden steht in Berlin diesen starken Zugangszahlen jedoch auch ein
enormer Mitgliederverlust gegenüber. Das folgend abgebildete Diagramm
verdeutlicht als Beispiel die Zu- und Abgangszahlen der Berliner Gemeinde
für das Jahr 1994, die in der Raten-Proportionalität den anderen Jahren seit
Beginn der "Vierten Welle" ähneln.
In der Hauptsache
entsteht der Mitgliederverlust durch Todesfälle innerhalb der großen Gruppe
der Hochbetagten, die sich sowohl aus alteingesessenen Mitgliedern als auch
aus GUS-Migranten zusammensetzt.
Die zweite Ursache des
Mitgliederverlustes sind Wegzüge aus Berlin, wobei die hier genannte Zahl
auch die "unbekannt Verzogenen" beinhaltet. Neben Umzügen in die alten
Bundesländer sind hier einige Weiterwanderungen in die USA, nach Kanada und
Israel zu verzeichnen sowie Rückwanderungen in die frühere UdSSR, letztere
jedoch in kaum nennenswerter Größe.
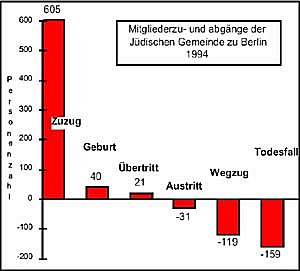
Die Zuzüge sind
überwiegend den sowjetischen Juden zu verdanken, die entweder direkt oder
über andere Bundesländer zugewandert sind. Bei den Übertritten ins Judentum
und bei den Austritten aus der Gemeinde spielen sie noch kaum eine Rolle,
aber bei den Geburten beginnt sich die Einwanderungswelle allmählich
bemerkbar zu machen. Ohne sie und die früher eingereisten sowjetischen Juden
(die bei den 177 gemeldeten Geburten der letzten fünf Jahre mit 62 %
beteiligt waren), wäre der Altersdurchschnitt heute noch höher, da die
Fertilität der einheimischen Juden noch unter der der sowjetischen Juden
liegt.
Die von
Gemeindefunktionären häufig geäußerte Hoffnung auf eine Verjüngung der
Gemeinden durch die Immigration aus der Ex-UdSSR ist so derzeit auch nur
z.T. berechtigt. Zwar hat sich der Anteil der über 60jährigen
Gemeindemitglieder im Bundesmaßstab seit 1989 von 32 % auf 27,5 % verringert
(ihre absolute Zahl hat sich dabei fast verdoppelt), die 41 - 50jährigen
Mitglieder machen als stärkste Gruppe jedoch allein bereits 17 % aus (1989
12 %), die bis 11jährigen dagegen lediglich 10 % (ZWST 1996). Die Proportion
zwischen Sterberaten und Geburtsraten zeigt bundesweit immerhin noch ein
Verhältnis von ca. 5,5 : 1.
Trotz enormer
Wachstumsraten in den einzelnen Altersgruppen
(114)
liegt der
Anteil aller bis 40-jährigen (die u.U. noch Kinder bekommen) Anfang 1996
noch immer 10 % unter dem Anteil aller über 40jährigen und hat sich damit
gegenüber 1989 lediglich um 1 % zugunsten der jüngeren Gruppe verschoben. Da
mit einem weiteren Zuzug eher älterer Menschen zu rechnen ist, könnten
derartige Gewinne jedoch auch wieder nivelliert werden. In der Berliner
Gemeinde hat sich das Gesamtverhältnis zwischen Jüngeren und Älteren sogar
verschlechtert: Hier liegt der Anteil der über 40jährigen derzeit mit 57 %
weit über dem Bundesdurchschnitt, ist also um 14 % höher als der Anteil der
unter 40jährigen und hat sich damit seit 1989 um 4 % zu Lasten der Jüngeren
erhöht .
Auch wenn sich die
jüdische Bevölkerung in der Bundesrepublik durch die Zuwanderung relativ
verjüngt hat (1970 lag ihr Durchschnittsalter noch bei 48 Jahren; [vgl.
Schmelz 1983, S.5]), ist sie gegenüber der Gesamtpopulation immer noch
überaltert, was jedoch mit dem demographischen Bild der Diaspora-Gemeinden
in aller Welt korrespondiert (115).
Ihre
diesbezügliche Zukunft wird so auch recht pessimistisch beurteilt: "The high
proportion of persons who have recently been of late middle age will cause
an increased proportion of old people among the Jews in the future" (Schmelz
1983, S.3f).
5.2. Selbstverständnis und Situation
im Sozialbereich
Jüdische soziale
Arbeit ist traditionell einzelfallorientiertes "casework" und hat den
Anspruch, Ursachen von Defiziten zu bekämpfen, präventiv, dialogorientiert,
sozialintegrativ und "moralisch rational" zu sein. Hier zeitgemäß
ausgedrückt, entstammen ihre Inhalte und Formen jedoch nicht "modernen"
Sozialkonzepten, sondern basieren bereits auf einer langen kontinuierlichen
Entwicklungslinie, die im ethischen Kodex des Judentums, in den sozialen
Prinzipien, Werten und Gesetzen der Tora und des Talmuds wurzeln (116).
Zur
talmudischen Denktradition gehört die Anerkennung von Regelungsbedarf und
sozialem Wandel ebenso wie z.B. das Recht auf Hilfe, auf Arbeit, auf
Bedürfnisbefriedigung und die Pflicht zur Hilfe, zur Arbeit, zur
Bedürfnisbefriedigung.
Daß das "biblische"
Konzept seine Tragfähigkeit bewahren konnte, erklärt sich vor allem aus der
praktischen, erzwungenen historischen Erfahrung der jüdischen Diaspora, die
gekennzeichnet ist durch eine beispiellose Kette von Verfolgungen und
Wanderungen: Um zu überleben, mußten die eigenen Sozialprinzipien und
Praktiken strikt angewandt und in einem ständigen Pendeln zwischen
empirischer Sicht und theoretischer Reflexion der jeweiligen Zeit und
Bedingung immer wieder neu angepaßt werden. Ideen, Werte und die von
Generation zu Generation tradierte kulturelle Erfahrung gingen letztlich als
"Ferment" in die eigene wie die bürgerliche Emanzipationsbewegung ein,
markierten die Anfänge der sozialen Wissenschaften wie die der Sozialarbeit
als eigenständigem Berufszweig. Damit rückten Fragen gesellschaftlicher
Mißstände, der Etablierung sozialer Sicherungen durch Gesetze, der
Weiterentwicklung/Aufarbeitung traditioneller Fürsorgeformen und der
Reformfähigkeit wie -bedürftigkeit auch in der Gesamtgesellschaft in den
Mittelpunkt.
Vor dem Hintergrund
der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, der Partizipation von Juden an der
wirtschaftlichen Dynamik, der vielen geflüchteten Ostjuden und der Angst,
deren Armut würde das Ansehen der ganzen Gemeinschaft mindern, entstanden
mit der Professionalisierung der jüdischen Wohlfahrt allein in Deutschland
zwischen 1850 und 1900 ca. 3000 (!) soziale jüdische Einrichtungen von
Arbeitsämtern bis Darlehenskassen und wegweisende Konzepte u.a. zur
Reformierung des Strafvollzugs, der Frauenarbeit, der jüdischen Berufs- und
Sozialstruktur, die in Form von Berufsumschulungsprogrammen nach dem
Machtantritt der Nazis noch einmal existentielle Bedeutung bekamen (vgl.
Kessler 1995, S.32).
Die wenigen
Überlebenden, die unmittelbar nach Ende des Weltkrieges begannen, den
jüdischen Sozialbereich wieder aufzubauen, konnten zwar nicht an dieses
weitverzweigte Netz, jedoch an Inhalte und Methoden anknüpfen (z.B. bei der
Einrichtung von In-Service-Trainings für KZ-Opfer oder "psychiatrischen
Teams" zur Unterstützung der Mitarbeiter). Die jüdische Sozialethik
begleitete trotz grundlegend veränderter Bedingungen und weitgehender
Säkularisierung die Praxis der jüdischen Sozialarbeit mindestens als
Anspruch weiter oder wieder, u.a. weil die Shoah zu einer radikalen
Rückbesinnung und Neubetrachtung des gesamten jüdischen Wertgefüges und
Selbstverständnisses geführt hat, weniger theoretisch und bewußt, sondern
zuallererst als Reflex auf ein Geschehen.
Derzeit gibt es unter
dem Dach der Zentralwohlfahrtsstelle und des Zentralrats der Juden 19
selbständige Jüdische Gemeinden und Landesverbände mit Gemeinden in
insgesamt 49 Städten (117).
Zahl und Umfang ihrer
sozialen Einrichtungen und das Ausmaß möglicher Hilfestellungen hängen
jedoch sehr stark von der Größe der einzelnen Gemeinden (und von deren
Gemeindepolitik) ab (118).
Die Berliner Jüdische
Gemeinde verfügte als größte Gemeinde Deutschlands bereits vor der letzten
Einwanderungswelle über ein weitverzweigtes sozial-kulturelles Netz, das im
Zuge der Zuwanderung vergrößert und erweitert wurde, mit der Aufgabe,
Zuwanderern das Einleben in die neue Umgebung zu erleichtern, Hilfe zur
Selbsthilfe zu bieten und letztlich jüdisches Leben zu vermitteln. Die
Standbeine der sozial-kulturellen Einrichtungen sind dabei wie in den
meisten Gemeinden die Jugend- und Seniorenbetreuung, die über eine, seit
1991 personell stark aufgestockte Sozialabteilung koordiniert wird.
Nachdem mit der
Nazi-Diktatur das jüdische Schul- und Erziehungssystem vernichtet sowie der
Religionsunterricht verboten worden war, gelang es nach 1945 sukzessive
zunächst schulexternen jüdischen Religionsunterricht, dann
Religionsunterricht an fünf Berliner Schulen und letztlich einen Jüdischen
Kindergarten und eine Jüdische Grundschule einzurichten, die seit 1994 in
Folge der Zuwanderung durch ein (Real- und Oberschule) ergänzt wird
(119).
Es wurde ein zweiter
Jugend- und Freizeittreffpunkt für Zuwanderer geschaffen, in dem u.a.
elementare Begriffe jüdischen Lebens und jüdischer sowie israelischer
Geschichte vermittelt werden, getrennt für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene und je nach Sprachkenntnissen in deutsch oder russisch. Das
Kursprogramm wird schrittweise in Kombination mit benachbarten Disziplinen
(z.B. der Archäologie) und verschiedenen Lerntechniken (u.a. Rollenspielen)
angeboten und durch Videofilme und eine Bibliothek ergänzt.
Neben verschiedenen
Zirkeln für angewandte und bildende Kunst, Tanz und Musik, die sich an alle
Altersgruppen wenden und z.T. von den Migranten selbst initiiert wurden,
haben Jugendliche die Möglichkeit, eine Ausbildung als Madrich
(Jugendleiter) zu absolvieren, um bei den Machanoth (jüdische
Kinderferienlager) als Betreuer arbeiten zu können. Deutsch- und
Computerkurse sind daneben Bestandteil der Initiativen der Ausbildungs- und
Berufsberatungsstelle von Gemeinde/ZWST. Hier werden auch überregionale
Integrationsseminare und Workshops der ZWST für u.a. Musiker, Lehrer und
Maler organisiert, in denen z.B. die letztgenannten mit den Strukturen des
deutschen Galeriensystems bekanntgemacht werden und Kontakte zu
einheimischen Galeristen vermittelt werden. Da etliche Migranten in der
Sowjetunion beruflich mit dem Kulturbereich zu tun hatten, versucht die
Gemeinde mit Kulturausschüssen, "Freundeskreisen" und Unterstützung
jüdischer und staatlicher Stellen öffentliche Ausdrucks- und
Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen und Künstlern den Weg in die
Selbständigkeit zu erleichtern. Ansatzpunkte sind dabei die Einrichtung
einer Jüdischen Galerie, der Einsatz von Migranten als Lehrer oder
Kursleiter (Malerei, Keramik, Tanz, Musik), Beratung bei der
Konzepterarbeitung für förderungsfähige Projekte, Bereitstellung von
Proben-, Auftritts- und Ausstellungsräumen, Vermittlung und Organisierung
von Veranstaltungen oder die Gründung eines Jüdischen Theaters
(120).
Im Seniorenbereich
gibt es - neben der Form der Einzelbetreuung, die durch
Sozialabteilungsmitarbeiter und ehrenamtliche Helfer realisiert wird -
mehrere Institutionen und Angebote für ältere Mitglieder, die seit 1990
zunehmend den sowjetischen Zuwanderern zugute kommen: das Jüdische
Krankenhaus (in dem eine Reihe von Zuwanderern arbeitet und die
"Organisation Jüdischer Ärzte und Psychologen" Berufsberatung für
sowjetische Ärzte anbietet), der Verein "esra" (für die psychologische
Beratung/Therapie von Shoah-Überlebenden), das Erholungs- und
Bildungsreisenprogramm in Westdeutschland und Israel, der Seniorenklub oder
das "Elternhaus" - ein Seniorenwohnzentrum
(121).
Obwohl das Berliner
Modell beispielgebend ist, soll die Aufzählung einiger Einrichtungen und
neuer Projekte für die Migranten nicht darüber hinwegtäuschen, daß sie den
Bedarf nicht decken können, u.a. weil die strukturellen und finanziellen
Kapazitäten der Gemeinde(n) durch die Größe der Gruppe überfordert sind. Die
Kürzung öffentlicher Gelder macht sich im übrigen auch hier erschwerend
bemerkbar. In vielen kleineren Gemeinden wird immer noch Notversorgung und
Improvisation betrieben. Auch für Berlin gilt, daß für einige Zuwanderer
immer wieder Minimalstandards und -rechte durchgesetzt werden müssen (das
betrifft z.B. nichtkontingentierte Zuwanderer und "ungeregelte"
Bundeslandwechsler).
Die Dimension der
Zuwanderung schafft wiederum neue Probleme auf anderen Ebenen. Es sei hier
nur ein Beispiel genannt: In der Berliner Jüdischen Grundschule sind in
einigen Klassen bis zu 3/4 der Kinder erst seit kurzem in der
Bundesrepublik; daraus ergeben sich qualitative Einbußen des Unterrichts und
Akzeptanzprobleme (siehe 5.3) (122).
Hinzu kommt,
daß Eingliederungsversuche der Gemeinde(n) den Intentionen etlicher
Zuwanderer auch entgegenstehen. Es ist verständlich und erwünscht, daß sich
die Migranten mit ihren Problemen zuerst an die Jüdische(n) Gemeinde(n) als
einen ihrer wenigen Bezugspunkte in Deutschland wenden. Und es ebenso
nachvollziehbar, daß materielle Fragen für die Neuankömmlinge
lebenswichtiger sind als eine Annäherung an das Judentum, die wenn
überhaupt, nur als allmählicher Prozeß vorstellbar ist. Aus Sicht der
Gemeinden bzw. ihrer Mitarbeiter bleibt dennoch problematisch, wenn sich die
Wünsche der Gemeinde gegenüber ausschließlich auf Familien-, Rechts-,
Sozialberatung, finanzielle Unterstützung, Konfliktbewältigung mit Behörden,
Übersetzungsdienste, Bereitstellung von Plätzen in Schulen, Kindergärten,
Altersheimen und vor allem auf die Suche von Wohnungen und Arbeitsplätzen
beschränken und gleichzeitig Bemühungen, Zuwanderern den Weg ins
Arbeitsleben zu erleichtern (z.B. durch das Angebot von berufsvorbereitenden
Kursen, Projekten, ABM-Stellen usw.), häufig auf zu wenig Resonanz stoßen
oder Arbeitsstellen und Wohnungen als "nicht gut genug" abgelehnt werden.
Auch wenn versucht
wird, den Wünschen der Zuwanderer und dem eigenen Anspruch an soziale Arbeit
gerecht zu werden, ist in vielen Gemeinden Hilflosigkeit und Ernüchterung
bei den Mitarbeitern zu spüren. Das liegt nicht nur an der Unmöglichkeit,
alle Bedürfnisse der Zuwanderer zu befriedigen. Es hat ebenso mit dem o.g.
historischen Kontext zu tun, aus dem Chancen und Barrieren resultieren, die
z.T. nicht einmal deutlich voneinander zu trennen sind. Von Vorteil ist hier
gewiß, daß die Arbeit mindestens der großen Gemeinden einen Gegenpol zur
staatlichen Ausländerpolitik bzw. -sozialarbeit darstellt, die überwiegend
an Konzeptionslosigkeit, Technokratie und mangelnder Fremdheitskompetenz
leidet. Fast alle Gemeinden verfügen inzwischen über russischsprechende
Mitarbeiter und sind bundesweit vernetzt. Die Mitarbeiter selbst haben
einige (meist eigene) Erfahrung mit der Exil-Problematik, werden regelmäßig
geschult und mit neuen Konzepten bekannt gemacht und versuchen, eine
unbürokratische, auf den sozialen Prinzipien des Judentums basierende
Sozialarbeit zu leisten. Obwohl diese Prinzipien längst allgemeine Praxis,
quasi "Gemeingut" sind, werden die Gemeinden damit aber auch oft zum Ersatz
(anstatt Zusatz) für zurückdelegierte staatliche Verantwortlichkeit oder
müssen Defizite auffangen, die aus der zunehmenden Rationalisierung des
Helfens in der Sozialpraxis resultieren. Andererseits führt die
personenzentrierte und empathische Art des Umgangs mit der Klientel in den
Gemeinden oft zu "overprotecting" bzw. zur Ausnutzung der Mitarbeiter oder
der Institution. Das Obenanstellen einer Gruppenzugehörigkeit und einer
soziomoralischen Verantwortung, die ein religiöses Ideal und eine
geschichtliche Erfahrung zum Maßstab nimmt, begünstigt eine Ideologisierung
auf Helfer- wie Klientenseite und kollidiert mit tatsächlichen
Erfordernissen und Möglichkeiten, überfordert die Mitarbeiter und erzeugt
"doublebinds" und Gewissenskonflikte (z.B. in Bezug auf die Tolerierung
unkorrekter Verhaltensweisen).
Die großen Gemeinden
sind im Gefolge des traditionell-jüdischen Selbstverständnisses von Hilfe,
gepaart mit den Forderungen und Bedürfnissen der Zuwanderer zu "jüdischen
Sozialämtern" und "Selbstbedienungsläden" geworden. Die neueren Konzepte aus
Israel, die nach langjähriger Erfahrung mit Einwanderern in die Richtung
gehen, die Abhängigkeit der Migranten von Integrationseinrichtungen und
vorhandene Passivität abzubauen, indem Migranten in ihrer Kultur, Sprache
oder/und der selbstgewählten Umgebung belassen und nicht mehr ganzheitlich
"an die Hand" genommen werden (z.B. auch nicht mehr in Wohnheimen
untergebracht werden), müssen sich in den deutschen Gemeinden - in dem Maße,
wie sie auch hier anwendbar sind - erst noch durchsetzen.
Dennoch sollte die
psychosoziale Betreuung für den Personenkreis weiter ausgebaut werden, der
ohne Hilfe nicht auskommt, besonders in Bereichen, die staatlicherseits
nicht abgedeckt werden. Gedacht ist z.B. an russischsprachige Psychologen
und Pflegekräfte, die mit dem kulturellen Hintergrund der Migranten vertraut
sind. Vor allem müßte perspektivisch die jüdische Altenarbeit erweitert
werden. Die bisherige Einwanderung hat gezeigt, daß die meisten Alten die
deutsche Sprache nicht mehr lernen, sich schlecht orientieren und in einer
"jüdischrussischen" Umgebung wenigstens einen Teil der Defizite kompensieren
können. Da bereits heute mehr als 40 % der Migranten über 50 Jahre alt sind,
werden in der nächsten Zukunft vor allem neue Seniorenheime,
Altentreffpunkte, Betreuungseinrichtungen usw. notwendig.
5.3. Einfluß und Akzeptanz der
Zuwanderer
Der heterogene
Mikrokosmos der jüdischen Gemeinschaft, deren Verbindungsglied zuallererst
und oft nur im Umstand des "Jüdisch-Seins" liegt, bietet Chancen und
"Sprengstoff" im Hinblick auf die Zuwanderung. Die Gemeinden bzw. ihre
Mitglieder sind bei ihrer Beurteilung der sowjetischen Migration gespalten:
"Das sind keine richtigen Juden" oder "falsche Juden" ist genauso zu hören,
wie die Meinung, mit der Einwanderung würde endlich wieder ein jüdisches
Leben in Deutschland beginnen. Wie so oft liegt die Realität irgendwo in der
Mitte: zunächst kommen die meisten "Neuen" in die Gemeinden, weil sie ohne
Hilfe nicht auskommen; etliche bleiben (im aktiven Sinne) und beginnen sich
wieder, oder erstmalig, mit ihren Ursprüngen und Traditionen zu befassen.
Ein Nebeneffekt der
Aufnahme sowjetischer Juden ist, daß sich angesichts der katastrophalen Lage
in der Ex-Sowjetunion nun jedoch auch Menschen durch die Ausreisemöglichkeit
ihrer Wurzeln besinnen bzw. jüdische Mütter per Urkundenfälschung "geboren"
werden. Obwohl das zwischenzeitliche Mißtrauen von Deutschen Botschaften und
Jüdischen Gemeinden mitunter die Falschen trifft, mußten schon in einem
Gemeindebericht zur Zuwanderer-Betreuung 1991 "Kreuze, Ikonen, Votivbildchen
in den Wohnheimzimmern" und Dokumente über die jüdische Herkunft zur
Kenntnis genommen werden, "die einer sorgfältigen Überprüfung nicht
standhalten". An anderer Stelle heißt es: "In den Wohnheimen kommt es schon
jetzt zu Reibereien zwischen jüdischen und nichtjüdischen
Kontingentflüchtlingen und offenen antisemitischen Äußerungen und
Aggressionsausbrüchen. Dies kann problematisch werden, zumal jedes negative
Auffallen von vermeintlich jüdischen Zuwanderern sich auf das Bild der
jüdischen Zuwanderer generell auswirken könnte".
Die Reaktionen u.a.
von Behördenmitarbeitern bestätigen diese Befürchtung (siehe auch 4.2.1).
Gleichzeitig ist mit der Zuwanderung generell "das unauffällige Leben der
Juden in Deutschland vorbei", wie die Zeitschrift GEO konstatiert (Büscher
1995, S.156). Ein Teil der deutschen und längeransässigen Juden befürchtet
erneut ein negatives Aufmerksamwerden der Öffentlichkeit und grenzt sich von
ihnen ab. Einige (meist jüngere) Vertreter Jüdischer Gemeinden äußern sich
in Berufung auf soziale Probleme der Bundesrepublik oder das "mangelnde
Judentum" der sowjetischen Juden abwartend oder ablehnend zu der Migration
(vgl. u.a. Mertens 1993,S.223). Neben der Furcht vor Veränderungen,
Konkurrenz und Forderungen der Migranten und obwohl auch die in der
Bundesrepublik lebenden Juden in der Mehrzahl säkularisiert sind und ihre
"Vermischung" mit der Umgebungsgesellschaft in den letzten Jahrzehnten wenn
auch unauffällig, so doch unaufhaltsam geschieht (1955 19 %, 1980 55% Ehen
mit Nichtjuden), können sie den sowjetischen Juden offenbar schwerer
verzeihen, daß diese ihnen den Spiegel einer möglichen Zukunft der jüdischen
Gemeinschaft vorhalten. Die Angst, die dahinter steckt, ist vielschichtig.
Die Juden haben in der
Bundesrepublik kaum mehr als symbolische Bedeutung und sie stehen nach wie
vor im Zwiespalt zwischen dem Wunsch nach Verarbeitung der Vergangenheit und
Gleichheit - dem Antisemitismus wie Philosemitismus entgegenstehen, "weil
man ihn niemals als Menschen, sondern immer und überall als den Juden
aufnimmt" (Sartre 1946,S.62) - und der Befürchtung, mit einer weitergehenden
Assimilierung würde sich das Judentum auflösen und mit ihm die jüdische
Identität.
An der Basis der
Gemeinde(n) ist es jedoch häufiger die Erwartungshaltung und der hohe
Anspruch der Migranten an soziale und materielle Unterstützung, die auf
Unmut und Ablehnung stoßen:
"Die neue
Zuwanderung ist eine Bereicherung für unsere Gemeinde. Die Juden wanderten
von Deutschland nach Rußland, warum soll das jetzt nicht umgekehrt sein.
Aber ich bin doch etwas enttäuscht. Als wir damals kamen, waren wir noch
anspruchslos, weil alle anspruchslos waren, auch die ganze Bevölkerung. Wir
sind aus dem KZ rausgekommen und haben bei Null angefangen. Die jetzt
kommen, denken, sie kommen zu den Reichen und erwarten Wunder. Sie müssen
auch versuchen, Initiative zu zeigen, was zu erreichen, zu machen. Nur dann
können sie ihre Identität wiedererlangen, nach ein paar Jahren. Das ist, was
ich als Rat geben kann - aber die Zuwanderer sind alle so schlau und wissen
immer schon alles besser; da zieht man sich manchmal zurück in sein
Häuschen."
(E., Rentner, 76)
"Viel Kontakt
mit den neuen Einwanderern haben wir nicht. Das sind ganz andere Leute als
wir damals. Heute kann jeder fahren, wer will. Die wollen sofort alles
haben, wofür wir zwanzig Jahre gebraucht haben.
[..]
Die Gemeinde
soll sich um die kümmern, die wirklich Hilfe brauchen, aber nicht einfach
so: Ich bin Jude, also gib! Du gehst in die Gemeinde, bekommst deine Mazze
oder Gutscheine, man hilft dir mit der Wohnung. Das wird alles wie
selbstverständlich angenommen, ob von der Gemeinde oder vom Staat."
(N., Arzt, 28)
Aus der großen Zahl
der Zuwanderer und der Konzentrierung der Gemeindearbeit auf ihre Probleme
und Bedürfnisse resultiert, daß sich ein Teil der Alteingesessenen
vernachlässigt und benachteiligt fühlt (bzw. es ist). Der Gemeinde wird
vorgeworfen, man "kämpfe" nur noch für und um die Zuwanderer, Russisch sei
die neue und einzige Amts- und Umgangssprache, Arbeitsplätze würden an
(weniger qualifizierte) Migranten vergeben, man kümmere sich zu wenig um
hilfsbedürftige Altmitglieder (denen vorher die ganze Aufmerksamkeit galt)
und um die alteingesessenen, faktisch ebenfalls "neuen" Mitglieder der seit
1991 angeschlossenen Ostberliner Gemeinde. Die Vorwürfe sind berechtigt,
soweit, wie die plötzliche Zuwanderung mehrerer Tausend Personen
Erfordernisse und Tatsachen schafft, die nicht ignoriert oder verhindert
werden können.
Obwohl die Gemeinde
bereits vor 1990 eine Einwanderergemeinde war und die Mitglieder historisch
wie individuell eine gewisse "Fremdheitskompetenz" und Flexibilität
gegenüber Veränderungen aufweisen, scheint die Toleranzgrenze bei einigen
Altmitgliedern überschritten zu sein. Es fällt ihnen schwer, zu akzeptieren,
daß "ihre" Gemeinde keine "deutsche" Gemeinde bleiben wird, daß sie
Konzessionen machen müssen, die "Neuen" im besonderen Umfang Hilfe benötigen
und andererseits nur durch die Zuwanderung weitere jüdische Einrichtungen
(z.B. die Schulen) und Projekte entstehen konnten (überhaupt einen Sinn
machen), die letztlich auch ihnen zugute kommen. Vielen Zuwanderern wiederum
reicht die gebotene Hilfe nicht aus. Bei ihrer Ankunft waren sie nicht
objektiv informiert und (in Berlin auch angesichts eindrucksvoller,
historischer und neuer jüdischer Stätten) davon überzeugt, daß sie nicht nur
in ein reiches Land, sondern auch in eine reiche jüdische Gemeinschaft
kommen, die sie bereitwillig und allumfassend für ihr bisheriges Leben
entschädigen wird. Zuvor als Juden stigmatisiert, erwarten sie nun als Juden
besondere, ja die größte Unterstützung gerade von den Jüdischen Gemeinden,
was schlicht an deren Möglichkeiten scheitert.
Falsche Vorstellungen
und Erwartungsenttäuschungen bestehen jedoch ebenso auf der Seite der
Einheimischen. Sie gehen davon aus, daß die Zuwanderer aus einem großen
Gefängnis kommen, wo die Unterdrückung alle Aspekte des Alltags betroffen
haben muß und daß sie eine Partizipation an der jüdischen Gemeinschaft
ersehnen, die ihnen bisher versagt war. Dementsprechend zufrieden und
"dankbar" für alles, was ihnen hier geboten wird, sollen sie sein und
dementsprechend aktiv müßten sie nun hier werden. Der Wunsch nach
(nicht-erwerbstätigkeitsschaffender) Teilhabe an der Gestaltung der Gemeinde
ist bei den Neuzuwanderern bislang jedoch wenig ausgeprägt. Bei den Wahlen
zu den Vorständen der einzelnen Berliner Synagogen kandidierte
bezeichnenderweise lediglich ein Zuwanderer der "Vierten Welle", drei aus
früheren russischen Einwanderungen. Alle anderen 16 Kandidaten waren
polnisch- oder deutschstämmige Juden (Berlin-Umschau Nr.9/1995). Bisher gab
es auch keine Bewerbungen von Neuzuwanderern zu einem Sitz in der
Repräsentantenversammlung der Gemeinde, anders als z.B. in der Gemeinde
Hannover, wo über die Hälfte der Kandidaten bei der letzten Wahl
Neuzuwanderer waren. Ihre Beteiligung in Berlin und in den meisten anderen
Gemeinden beschränkt sich derzeit im besten Fall auf die Stimmabgabe für
konkurrierende Gemeinde-Parteien. Bei deren Konflikten geht es dennoch
bislang weniger um die Neuzuwanderer selbst oder um Auseinandersetzungen
zwischen ihnen und den Alteingesessenen (auch wenn die wenigen aktiven
Neueinwanderer zu monieren beginnen, daß ihre Gruppe, als inzwischen
quantitative Majorität, in den Entscheidungsgremien der Gemeinden noch kaum
vertreten ist); sie geraten vielmehr in das Kreuzfeuer eines allgemeinen
Generationswechsels bzw. das Bestreben jüngerer Altmitglieder nach
Veränderungen.
Bislang ist es den
Gemeinden bundesweit nur unzureichend gelungen, über ihre neue Rolle als
"Dienst-leistungsgroßunternehmen" hinaus auch die Notwendigkeit
gemeindegestalterischer Aktivitäten oder Pflichten an ihre neuen Mitglieder
zu vermitteln. Und ihr eigentliches Anliegen, Judentum weiterzugeben und zu
binden, gelingt ihnen bis dato allenfalls bei der jüngsten Generation und
den ganz Alten. Mehr zu wollen, ist auch unrealistisch. Die altansässigen
Juden erwarten etwas, was sie selbst in der Mehrzahl kaum noch haben:
Religions- und Traditionsbewußtsein, und monieren an den "Neuen", was sie
noch nicht haben: ein weniger ideologisiertes/politisiertes Verhältnis zur
Umgebungsgesellschaft bzw. ein weniger schlechtes Gewissen bei der Symbiose
mit ihr.
Zu hoffen bleibt trotz
allem, daß zukünftig noch mehr Alteingesessene und alle Gemeinden beginnen,
die Unterstützung der Neuzuwanderer bei ihrer Annäherung an das Judentum als
positive Herausforderung zu betrachten und andererseits (auch auf die Gefahr
einer noch stärkeren Verwässerung der jüdischen Kultur, ihre Veränderung in
eine "jüdisch-russische" Variante oder eine Spaltung der Gemeinden hin) von
ihnen zu lernen und ihre Offenheit, Flexibilität und brachliegende
Potentiale zu nutzen.
6. Resümee und
Ausblick
Von fast einer Million
Juden, die zwischen 1945 und 1995 die UdSSR und ihre Nachfolgestaaten
verlassen haben, ist erst seit 1990 und im Zuge einer gesetzlichen
Aufnahmeregelung eine größere Gruppe von inzwischen etwa 40.000 Personen
auch nach Deutschland eingewandert. Ziel der vorliegenden Arbeit war es,
Daten über die Zusammensetzung dieser Gruppe, ihre Migrations- und
Lebensumstände zu gewinnen.
Die Betrachtung ergab,
daß eine Palette von Gründen - bei denen Antisemitismus eher als latente,
u.U. Panik erzeugende Größe mitwirkt - sowjetische Juden zum Auswandern
veranlaßt (hat): Nationalitätenkonflikte, Umweltkatastrophen,
Perspektivlosigkeit für die nachwachsende Generation, fehlende soziale
Absicherung der Älteren, berufliche Beschränkungen oder die instabile
wirtschaftliche und politische Lage, und auf der anderen Seite hohe
Erwartungen an Deutschland und die Zuversicht auf eine sichere Zukunft. Der
bleibende Zustrom ist daneben der Sogwirkung durch bereits migrierte
Angehörige und Freunde bzw. dem Wunsch, in ihrer Nähe zu leben, zu
verdanken.
Die Entscheidung der
Bundesrepublik, ihre Einreise zu gestatten, verfestigt die mehrheitliche
Ansicht der Migranten, die Deutschen hätten aus der Vergangenheit gelernt,
obwohl sie die politische Situation nach längerem Aufenthalt als bedenklich
einschätzen und antisemitische bzw. fremdenfeindliche Vorfälle im
Zeitverlauf zunehmen. Da die USA, das Traumland sowjetischer Juden, die
Einwanderung stark beschränkt hat und Israel von vielen als
politisch/wirtschaftlich zu unsicher oder als zu fremd/orientalisch
angesehen wird, bleibt Deutschland in der Wahrnehmung (bzw. Erwartung) der
Zuwanderer die günstigste Alternative: reich, weltoffen, europäisch,
ähnlich.
Über 90 % der (4.006
erfaßten) Migranten sind so auch im europäischen Teil der früheren UdSSR und
über die Hälfte in den Großstädten Moskau, Dnepropetrowsk, Odessa, Kiew,
Riga und Leningrad/St. Petersburg geboren. Doch kommen nur 34 % der
"russischen" Juden aus Rußland; 39 % sind aus der Ukraine, 13,5 % aus den
baltischen Republiken, 6 % aus Weißrußland und Moldawien, 5 % aus den
Kaukasus-Republiken und 2,5 % aus Mittel-asien.
In der 1.Phase der
Einwanderungswelle bis Anfang 1991 reisten jüngere, aber nicht ausgesprochen
junge Leute ein; die stärkste Gruppe war die der 30 - 40jährigen. Es
überwogen Einzelpersonen und Kleinfamilien. Sie kamen spontan mit einem
Koffer in der Bundesrepublik an, wirkten risikofreudig und gleichzeitig
unsicher. Nach der Änderung der Einreisemodi und ausgestattet mit
Informationen bereits Ausgereister kommen besser vorbereitete, vollständige
Familien, aber auch alleinerziehende Mütter und betagte Menschen.
Durch die stufenweise
Migration gesamter Verbände familiär, sozial und örtlich verbundener
Personen ist die Altersstruktur der jüdischen Migrantengruppe ein
Spiegelbild des zurückgebliebenen Teils der Ethnie, der durch Überalterung
und geringe Geburtenraten gekennzeichnet ist. 14,5 % der Berliner Gruppe
sind zwischen 0 und 18 Jahre alt, 58,5 % zwischen 19 und 60 Jahre und 27 %
über 60 Jahre alt. Die einzelnen Altersjahrgänge der derzeit 35 - 50jährigen
und 55 - 69jährigen Migranten sind am stärksten besetzt, die der 0
-10jährigen am schwächsten und noch um 1/3 kleiner als die der 70 -
80jährigen. In Berlin führt eine Sonderregelung zur Familienzusammenführung
zum verstärkten Zuzug Älterer außerhalb des langwierigen offiziellen
Aufnahmeverfahrens, so daß sich die Altersstruktur für die
Gesamtbundesrepublik bislang noch etwas günstiger darstellt: die Gruppe der
über 60jährigen macht hier "nur" etwa 23 % aus, dies zugunsten der etwa 18 %
bis 18jährigen. Da sich die Berliner Migranten im Durchschnitt am längsten
in der Bundesrepublik aufhalten und sich zeigt, daß Eltern meist dann
nachziehen, wenn sich ihre Kinder einigermaßen "eingerichtet" haben, ist
anzunehmen, daß auch in andere Bundesländer zukünftig mehr Ältere nachreisen
werden und sich die Altersstruktur der Gesamtgruppe, die für eine
Zuwanderergruppe bereits jetzt extrem "alt" zu nennen ist, den Berliner
Proportionen angleichen wird.
Die
Geschlechterverteilung ist mit 49 % Männern und 51 % Frauen recht
ausgeglichen, wobei Männer bei den 30 - 50jährigen leicht und Frauen bei den
über 60jährigen deutlich dominieren; die alleinstehenden Männer reisten
hauptsächlich zu Beginn der "Vierten Welle" ein, während später
überproportional viele ältere Frauen folgten. Diese älteren Migrantinnen
machen einen erheblichen Teil der 12 % verwitweten Zuwanderer aus; abzüglich
der Minderjährigen waren ferner 58 % der Berliner Migranten bei der Einreise
verheiratet, 12 % waren geschieden und 18 % ledig.
Bei den jüdischen
Zuwanderern überwiegt die Ein-Kind-Familie; diejenigen mit mehr als zwei
Kindern stammen in den meisten Fällen aus dem asiatischen Teil der UdSSR
bzw. aus orientalischen Familien. So machen die Haushalte mit 4 und mehr
Personen nur 11 % der Berliner Gruppe aus; 2-Personen-Haushalte liegen mit
33 % an der Spitze, gefolgt von Single-Haushalten mit 29 % und
3-Personen-Haushalten mit 27 %. In anderen Bundesländern dürften Haushalte
mit mehr als 3 Personen aufgrund der zeitgleichen Einreise vollständiger
Mehr-Generationen-Familien im geregelten Verfahren bislang noch stärker
vertreten sein. Ein weiteres Spezifikum der jüdischen Zuwanderer ist ihre
überdurchschnittlich gute Ausbildung: Über 2/3 aller Männer und Frauen sind
Akademiker, lediglich 2 % der Gruppe verfügen über keinen Berufsabschluß.
Ingenieure bilden die größte Einzelgruppe, gefolgt von Lehrern, Ärzten,
Ökonomen und Musikern. Insgesamt waren die meisten Migranten in der
Sowjetunion im Bereich Technik, Industrie und Bau (29 %), den
kaufmännischen, Handwerks- und Dienstleistungsbereichen (27 %), den Sektoren
Bildung, Kunst und Medien (20 %) sowie Medizin/Pharmazie (15 %) beschäftigt.
Zuwanderer im erwerbsfähigen Alter waren in der früheren UdSSR durchgängig
beschäftigt, häufig auch über das reguläre Rentenalter hinaus, bezogen ihre
gesellschaftliche Akzeptanz aus meist guten beruflichen Positionen und waren
vergleichsweise materiell privilegiert.
Die Mehrheit der
Migranten hatte unrealistische Erwartungen an ihr Leben in der
Bundesrepublik, an deren Stelle zunächst eine Art Bittstellerposition tritt,
Arbeitslosigkeit, das Leben in einem Wohnheim auf engstem Raum und eine
staatlich verordnete Wohnsitzbeschränkung auf einen bestimmten, i.d.R. nicht
selbst gewählten Ort. Die damit verbundenen Erwartungsenttäuschungen, die
für den "homo sovieticus" ungewohnte Eigenverantwortlichkeit, das
Bewußtwerden des Heimatverlustes, die Begegnung mit einer fremden Sprache
und Kultur führten bei einem Teil der Migranten zu psychischen Problemen und
Sinnkrisen, die von den isolierten Betagten, den arbeitslosen "jungen
Älteren" und den vielfach überforderten Kindern besonders schwer bewältigt
werden.
Kinder und Jugendliche
sind in aller Regel fast ganztägig mit dem regulären Schulbesuch und
Förderunterricht beschäftigt. Junge Migranten setzen häufig ihr Studium fort
bzw. haben ein neues begonnen. Etwa Dreiviertel der 20 - 60jährigen
Zuwanderer sind nach eigenen Angaben beschäftigungslos. Die Mehrzahl der
Erwerbstätigen arbeitet aufgrund nichtanerkannter Berufsabschlüsse,
fehlender Zugänge zu qualifizierten Arbeitsbereichen oder mangelnder Sprach-
bzw. beruflicher Kompetenzen in einem anderen als dem erlernten Beruf, wobei
Frauen eher als Männer bereit sind, Arbeiten zu übernehmen, die nicht ihrer
Qualifikation entsprechen oder sich umschulen zu lassen. Technischen
Spezialisten und Personen aus künstlerischen Bereichen (Maler, Musiker, z.T.
Schauspieler) gelingt der Wiedereinstieg am häufigsten;
Gesellschaftswissenschaftler und über 50-jährigen am seltensten. Besonders
Lehrer, Ärzte und Wissenschaftler sind bereit, langwierige kostenlose
Praktika und Hilfsdienste zu übernehmen, in der Hoffnung, daß sich diese
Investition in der Zukunft auszahlen wird. Ein Teil der Zuwanderer hat sich
- meist innerhalb des russischsprachigen Umfeldes - mit handwerklichen und
gastronomischen Dienstleistungsunternehmen oder Handelsfirmen selbständig
gemacht. Migranten, die auf dem deutschen Arbeitsmarkt keine Arbeit gefunden
haben, üben teilweise informelle Erwerbstätigkeiten aus bzw. pendeln zu
diesem Zweck zwischen der Bundesrepublik und der Ex-Sowjetunion.
Die Situation im
Wohnbereich stellt sich günstiger dar, wird von dem Migranten selbst am
besten beurteilt und verweist auf ihr hohes Mobilitätspotential. Trotz
Sprachproblemen, eines überlasteten Marktes und bürokratischer Hürden ist es
einem Großteil der Zuwanderer gelungen, ihren Vorstellungen entsprechende
Wohnungen zu finden, sich regionalen (auch vermeintlichen) Disparitäten
durch Abwanderung zu entziehen, den Wohnsitz in die gewünschte Großstadt zu
verlegen und Familienangehörige nachziehen zu lassen: In Berlin verbrachte
der überwiegende Teil kleinerer Familien unter einem Jahr und der größerer
Familien zwischen ein und zwei Jahren in einem Übergangswohnheim. Über die
Hälfte aller Migranten hat mehrfache Umzüge unternommen; in peripheren
Neubausiedlungen und Gebieten mit schlechter Altbausubstanz leben nur noch
etwa ein Viertel der Zuwanderer, doppelt so viele wohnen inzwischen im
Stadtzentrum und häufig in gewünschter, unmittelbarer Nähe von Angehörigen.
Die Fluktuation aus dem Ostteil Berlins und aus den neuen Bundesländern ist
besonders groß: über die Hälfte der Ostberliner Migranten ist in den
Westteil der Stadt gezogen und etwa 2/3 der im geregelten Verfahren
eingereisten Mitglieder der Berliner Jüdischen Gemeinde kommen aus den neuen
Bundesländern, in denen - wie auch in westdeutschen Kleinstädten - die
Arbeits- und Wohnungsmarktlage für die Zuwanderer deutlich schlechter als in
Berlin und in westdeutschen Großstädten zu beurteilen ist.
Mit bzw. nach der
Lösung ihres Wohnungsproblems konnte die Mehrheit der etwas länger
ansässigen Migranten den aus der Heimat gewohnten Lebensstandard und -stil
wiedererlangen bzw. verbessern; dennoch lebt ein erheblicher Teil (nach
eigenen Angaben etwa 2/3) noch von Transferleistungen,
Erwerbsersatzeinkommen oder Kleinverdiensten und reichen die finanziellen
Mittel bei kinderreichen Familien und alten Menschen oft nicht aus.
Anzeichen eines
allmählichen "Sich-Einrichtens" sind Eheschließungen und sukzessiv steigende
Geburtenzahlen innerhalb der russischsprachigen Gruppe, aber auch Um- und
Neuorientierungen, besonders bei der jüngeren Generation. Dazu gehört u.a.,
daß Kinder ihre Eltern mit der Übernahme hiesiger "Normen" und Möglichkeiten
in Seniorenheimen "abgeben" und die sprichwörtliche Solidarität abhanden
gekommen ist, die wohl nur innerhalb der Notgemeinschaft des Sozialismus
funktioniert hat und nun teilweise durch Konkurrenzdenken ersetzt wird.
Ältere Migranten und orientalische Juden bewältigen die Anforderungen der
neuen Umgebung (z.B. den Spracherwerb) und den Verlust ihrer
gesellschaftlichen Positionen und sozialen Beziehungen am schlechtesten und
leben am häufigsten isoliert. Intensivere Kontakte zu Deutschen sind bei
ihnen noch seltener als bei den jüngeren Migranten, von denen ein Teil die
deutsche Sprache bislang ebenso unzulänglich beherrscht oder "unter sich"
bleiben und die bisherige Lebensweise beibehalten möchte. Die Migranten
weisen starke Bindungen an ihre Heimat, deren Kultur und an die eigene(n)
Gruppe(n) auf. Die relative Vollständigkeit der ethnischen Einrichtungen und
die Größe der Gruppe bildet - vor allem in Berlin und einigen westdeutschen
Großstädten - eine tragfähige Basis für Eigenabgrenzungen oder den Erhalt
und Ausbau gewohnter Kultur- und Beziehungsmuster.
Kinder, junge und
"außenorientierte", meist höhergebildete Zuwanderer haben die häufigsten
Beziehungen zur deutschen Umgebung und orientieren sich an ihr ebenso wie an
der russischsprachigen Gruppe. Kontakte zur einheimischen Bevölkerung
scheitern jedoch oft an wahrgenommenen Mentalitäts- oder Kulturunterschieden
und an der Konfrontation mit negativen Vorurteilen und Diskriminierung auf
formeller wie informeller Ebene. Gleichfalls erleben die Migranten als Juden
und Ausländer positive Vor-Urteile bzw. eine partielle Subventionierung.
Beides steht einer "Normalität" im Umgang entgegen und bedient gegenseitige
Unsicherheiten und Mißtrauen.
Auch zwischen
Migranten und einheimischen Juden waren gegenseitige Abgrenzungen und
Erwartungsenttäuschungen festzustellen: Zum einen reicht vielen
Neuzuwanderern die Hilfe der Jüdischen Gemeinden - die im Sinne der
jüdischen Sozialprinzipien eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe sein sollte -
nicht weit genug und sind sie in gemeindepolitischen Repräsentanzorganen
noch kaum vertreten; andererseits fühlt sich ein Teil der alteingesessenen
Mitglieder, deren Problemen zuvor die gesamte Aufmerksamkeit galt,
vernachlässigt und benachteiligt bzw. infolge der Sprach- und Kulturdominanz
der Migranten im Abseits, da diese in etlichen Gemeinden inzwischen die
quantitative Majorität stellen und mit der Verschiebung des Fokus der
Gemeinden auf ihre Bedürfnisse in Kinder- und Senioreneinrichtungen, bei
Reisen, Seminaren, Wohnungsvergaben usw. den Vorrang haben. Zum anderen
strebt ein kleinerer Teil der Zuwanderer den Kontakt zu einheimischen Juden
oder Jüdischen Gemeinden nicht an oder kann nach jüdischem Recht nicht
Mitglied einer Gemeinde werden; für einen Teil der einheimischen Juden sind
die Migranten wiederum homogen "Russen" oder "zu wenig jüdisch". Deren
Selbstdefinition ist ähnlich indifferent: in über 70 Jahre Sowjetmacht
größtenteils abgeschnitten vom Judentum, bewahrten sie ihre jüdische
Identität mehr oder weniger nur durch den Paßeintrag "Jude" und die
Reaktionen ihrer Umwelt, wurden zugleich aber durch heterogene regionale,
soziale und kulturelle Herkunftskontexte geprägt. Interethnische Familien
machen zwischen 30 und 50 % der Gesamtgruppe aus, jiddischsprachige Personen
sind in der Minderheit und das kulturelle und religiöse Wissen über das
Judentum und entsprechende Bindungen sind insgesamt gering. Nach der
schwierigen Anfangszeit in der Migration entdecken und entwickeln jedoch
besonders Kinder und Jugendliche erste und Ältere wieder Verbindungen zum
Judentum, gefördert durch die massive Intervention jüdischer Gemeinden,
Vereine und Einzelpersonen.
Durch die Zuwanderung
haben sich die Mitgliedszahlen der Jüdischen Gemeinden fast verdoppelt und
wurden Gemeinden an Orten gegründet, wo es nach 1945 keine Juden mehr gab.
Von einer Erneuerung im Sinne genuin jüdischen Lebens kann bislang jedoch
noch kaum die Rede sein und auch die Hoffnungen auf eine Verjüngung haben
sich nur teilweise erfüllt; die Gemeinden sind nach wie vor überaltert, die
Sterberate noch über fünfmal so hoch wie die Geburtenziffer.
Gesamtgesellschaftlich haben die 40.000 jüdischen Migranten - gegenüber
1.120.000 im gleichen Zeitraum aus der früheren Sowjetunion eingereisten
deutschen Aussiedlern - kaum mehr als symbolische Bedeutung; die jüdische
Gemeinschaft und ihr Bild in der Öffentlichkeit werden sie - u.a. mit ihrer
Innovationsfähigkeit und ihren kulturellen Impulsen, die bereits jetzt auch
das Kulturleben deutscher Großstädte sichtbar beeinflussen und zum
Verständnis zwischen Nichtjuden und Juden beitragen - über kurz oder lang
nachhaltig verändern.
Die weitere Migration
der, in ihren Herkunftsregionen bereits stark reduzierten und geschwächten
jüdischen Ethnie wird vor allem von der politischen und wirtschaftlichen
Entwicklung in der früheren Sowjetunion abhängen. Zur Zeit sieht es jedoch
nicht danach aus, daß sich die Prognose über eine flutartige
Auswanderungswelle, wie sie noch Anfang der 90er Jahre für die sowjetische
Gesamtbevölkerung gestellt wurde, bestätigen würde. Auch die "Vierte Welle"
scheint allmählich wieder abzuflauen.
Für diejenigen, die
zukünftig in die Bundesrepublik einwandern wollen oder werden, sollten sich
hiesige Institutionen in Zusammenarbeit mit jüdischen Gemeinden, wie sie
bislang noch selten stattfindet, bereits im Vorfeld zuständig zeigen, um
Entscheidungsfindungen bzw. die Migration selbst zu erleichtern: durch
gezielte Informationen z.B. der Botschaften über Bedingungen, die die
Migranten in Deutschland erwarten (Wohnungs- und Arbeitsmarkt, nachgefragte
Berufe, Rechts- und Versorgungssystem usw.) oder durch die Erleichterung von
Besuchs- und Informationsreisen.
Ghetto- und KZ-Opfern
sollte die Bundesrepublik auch
in
der GUS Unterstützung
gewähren, so daß sie nicht aus finanziellen Gründen gezwungen sind,
auszureisen. Bei der Erteilung der Aufnahmezusage und des Aufenthaltsortes
wäre wünschenswert, daß mehr als bisher darauf Rücksicht genommen wird, wo
die Verwandten der Einreisenden leben. Die Wohnsitzbindung ist als wenig
sinnvoll anzusehen (Abhilfe würde eine nicht-kommunale
Aufenthaltsfinanzierung schaffen), ebenso wie die Unterbringung in
ländlichen Regionen ohne notwendige Infrastrukturmerkmale.
Bei der Eingliederung
der Migranten sind - auch im Interesse des deutschen Arbeitsmarktes -
Angebote zur Berufsanpassung und zum qualifizierten Spracherwerb notwendig,
ferner solche zur Defizitkompensation im Umgang mit Heimat- und
Statusverlusten, mit der hiesigen Kultur und dem unterschiedlich schnellen
Wertewandel einzelner Generationen. Diese können wiederum nur greifen, wenn
die spezifische, "andersartige" und zudem unterschiedliche Sozialisation und
Sozialstruktur der Migranten in den Konzepten akzeptiert und berücksichtigt
wird und Varianten für verschiedene Gruppen (je nach Beruf, Alter,
regionaler Herkunft usw.) erstellt werden.
Die Aufgabe der
Jüdischen Gemeinden wird es vor allem sein, die Migranten in ihrer
Identitätsfindung als Juden zu bestärken, sie ihrer Zugehörigkeit zur
jüdischen Gemeinschaft zu vergewissern, Vorurteile bei den eigenen
Mitgliedern abzubauen und stark hilfsbedürftige Gruppen wie Kinder und alte
Migranten in besonderem Maße zu unterstützen und einzubinden.
ANHANG
Erhebungsbogen:
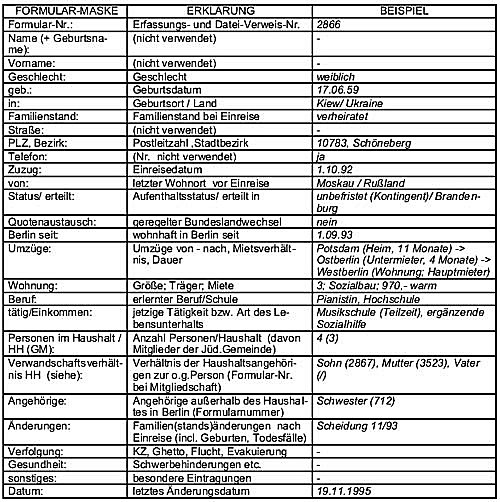
Tabelle A:

Tabelle
B:
Alter und Geschlecht der Zuwanderer
3.950 Pers./31.12.1995
(ohne Geburten nach Einreise)
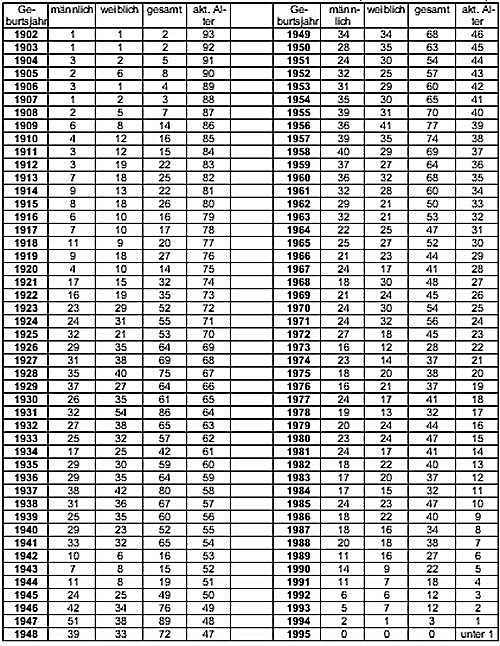
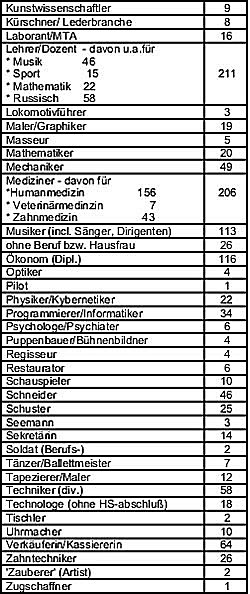 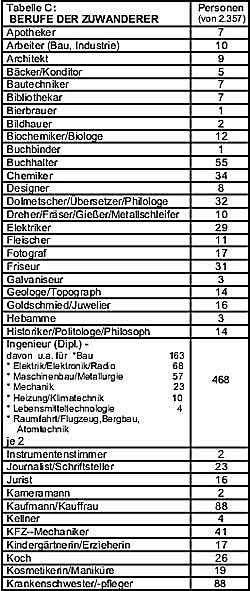
Jüdische Migranten
und deutsche Aussiedler im Vergleich
(zu 3.)
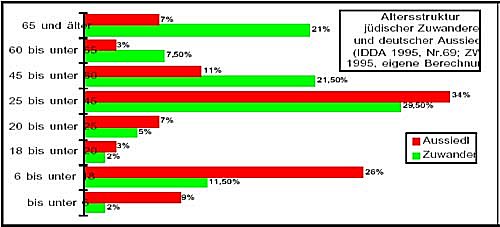
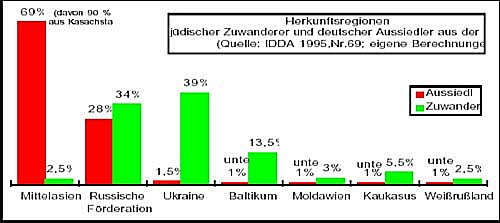
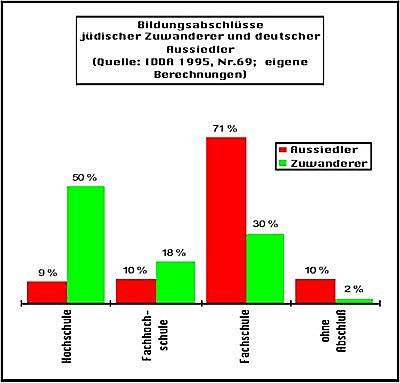
Literaturverzeichnis
Allgemeine jüdische
Wochenzeitung (AJW):
- Mal umquotiert, mal ausquartiert. In: Nr.45/48, 1990 Bonn
- Großzügig nur für "eine begrenzte Zahl". In: Nr. 45/50, 1990 Bonn
- Über die Einwanderung zerstritten. In: Nr.46/2, 1991 Bonn
- Ist die erst junge Demokratie gefährdet? In: Nr.47/33, 1992 Bonn
Bade,K./Troen,S.(Hg.)
1993: Zuwanderung und Eingliederung von Deutschen und Juden aus der früheren
Sowjetunion in Deutschland und Israel. Bonn
Basse, L. 1995:
Konzeption für eine Beratungstelle zur beruflichen Integration jüdischer
Einwanderer. ZWST-Berlin (intern)
Beck, U. 1986:
Risikogesellschaft. Frankfurt
Benz, W. 1991:
Dimension des Völkermords. München
Berliner Zeitung:
Sowjetische Juden auf der Flucht nach Deutschland. 31.5.1990 Berlin
Bertels,L./Herlyn,U.(Hg.) 1990: Lebenslauf und Raumerfahrung. Opladen
Bertels, L. 1991:
Migration und Lebenslauf. Kurs 3649. Fernuniveristät Hagen
Beth Hatfutsoth 1983:
The jewish Agricultural experience in the Diaspora. Tel Aviv
Bland-Spitz,D. 1980:
Die Juden und die jüdische Opposition in der Sowjetunion. Diessenhofen
Bundesinnenministerium
1996: Aussiedler-Statistik. Bonn
Bundesverwaltungsamt
(BVA) 1995: Verteilung jüdischer Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion.
Köln
Burchard,
A./Duwidowitsch,L. 1994: Das russische Berlin. Berlin
Büscher,W. 1995: Davids
deutsche Sterne. In. GEO, Nr.5/1995,S.146-158
Delfs, S. 1993:
Heimatvertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler. In: Aus Politik und
Zeitgeschichte, B 48/93, S.3-11
De Riz, P. 1979:
Mobilität und Integrationsverhalten ausländischer Arbeitnehmer, Frankfurt/M.
DER SPIEGEL: - "Gewalt,
Gewalt, Gewalt". In: 8/1994, S.147-152
- Ausgerechnet ein Jude. In: 16/1994, S.173-180
- Rückkehr nach Charlottengrad. In: 35/1995, S.60-65
- Frust auf der Galerie. In: 32/1995, S.59-60
Diakonie-Korrespondenz
1995: Stellungnahme zur aktuellen Aussiedlerarbeit. Heft 10/1995. Stuttgart
Dietz, B. 1990:
Deutsche Aussiedler aus der Sowjetunion. München
DIE WOCHE 26.1.1996:
Ein Jude als Kanzler? In: Heft 3/1996, S.27
Duwidowitsch.L./Dietzel,V. 1993: Russisch-jüdisches Roulette. Jüdische
Emigranten erzählen ihr Leben. Zürich
Eisenstadt, S. 1954:
The Absorption of Immigrants. London
Eisfeld, A. 1993:
Zwischen Bleiben und Gehen: Die Deutschen in den Nachfolgestaaten der
Sowjetunion. In: Aus Politik und Zeitgeschehen, B 48/93
Erikson, E. 1965:
Kindheit und Gesellschaft. Stuttgart
Esser, H. 1980: Aspekte
der Wanderungssoziologie. Darmstadt/ Neuwied
Estel, B. 1993: Nation
und nationale Identität. Kurs 3624. Fernuniversität Hagen
Finkielkraut, A. 1984:
Der eingebildete Jude. Frankfurt
Fischer, L. 1987:
Psychologie sozialer Minoritäten. Kurs 3276. Fernuniversität Hagen
Fischer, W./Kohli,
M.1987: Biographieforschung. In: Voges, W.(Hg.): Methoden der Biograpie- und
Lebenslaufforschung, S.25-50. Opladen
Flierl, H. 1992: Freie
und öffentliche Wohlfahrtspflege. München
Freinkman,
N./Fijalkowski, J. 1992: Jüdische Emigranten aus den Ländern der ehemaligen
Sowjetunion, die zwischen 1990 und 1992 eingereist sind und in Berlin leben.
FU Berlin
Friedmann,A. et al
(Hg.) 1993: Eine neue Heimat? Jüdische Emigrantinnen und Emigranten aus der
Sowjetunion. Wien
Frogner, E. 1994:
Probleme der Migrationssoziologie aus der Lebenslaufperspektive. In:
Cropley.A. et al, Probleme der Zuwanderung, S.105-129, Göttingen/Stuttgart
Götz, R. / Halbach, U.
1993: Politisches Lexikon GUS. München
Hansen, G. 1994:
Einführung in interkulturelle Studien. Kurs 3831. Fernuniversität Hagen
Heckmann, F. 1992:
Ethnische Minderheiten, Volk und Nation. Stuttgart
Hoernig, E. 1987:
Lebensereignisse: Übergänge im Lebenslauf. In: Voges,W.(Hg.): Methoden der
Biographie- und Lebenslaufforschung, S.231-260, Opladen
Hoffmann-Nowotny, H.-J.
1973: Soziologie des Fremdarbeiterproblems. Stuttgart
Info-Dienst Deutsche
Aussiedler (IDDA) 1995: Deutsche Aussiedler. Heft 69 (Juli 1995) Bonn
Infratest
Sozialforschung 1995: Bericht zur sozialen Lage im Land Berlin. Berlin
Israelitische
Religionsgemeinschaft Würtembergs (Hg.) 1994: Jüdische Einwanderung aus den
Ländern der ehemaligen Sowjetunion nach Stuttgart. (Autoren u.a.: Meier, W./
Bürkle, G.) Stuttgart
Karsten, M.-E. 1986:
Migrationsleben. Migrationslebenszeiten. Kurs 3805. Fernuniversität Hagen
Kessler, J. 1995: Von
Aizenberg bis Zaidelman. Jüdische Zuwanderer aus Osteuropa und die Jüdische
Gemeinde heute. Berlin
Kohli, M. (Hg.) 1978:
Soziologie des Lebenslaufs. Darmstadt/Neuwied
Kohnen,G./Hielscher,K.
1991: Die schwarze Front. Reinbek
Koller, B. 1993:
Aussiedler in Deutschland. Aspekte ihrer sozialen und beruflichen
Eingliederung, In: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 48/93, S.12-22
Landesamt für Zentrale
soziale Aufgaben (LASoz) 1990-1995: Aussiedler-, Asylbewerber-,
Kontingentflüchtlingsstatistiken. Berlin
Maariv. (Tageszeitung)
1995: Zur Studie des Statistikzentralamtes über die Alija-Jahre. 26.10.1995,
Tel Aviv
Mull, U. 1994: Die
Jüdische Oberschule in Berlin. In: schulmanagement. 1/1994, S.30-35,
Braunschweig
Lüthke, F. 1989:
Psychologie der Auswanderung. Weinheim
Mayer, K.U. 1994:
Wiedervereinigung, soziale Kontrolle und Generation. In: Bertels,L. (Hg.),
Gesellschaft, Stadt und Lebensverläufe im Umbruch. Bad Bentheim, S.49-66
Mertens, L. 1993:
Alija. Die Emigration der Juden aus der UdSSR/GUS. Bochum
Nuscheler, F. 1990:
Flucht und Asyl. Kurs 4658. Fernuniversität Hagen
Olk, Th./Otto, H.-J.
1987: Soziale Dienste im Wandel, Bd.1. Neuwied/Darmstadt
Oswald, I. 1993:
Nationalitätenkonflikte im östlichen Teil Europas. Berlin
Pinkus, B. 1988: The
Jews of the Soviet Union. Cambridge/New York
Poliakov, L. u.a. 1992:
Rassismus. Hamburg/Zürich (zuerst 1976 Paris)
Roth, P. 1990: Glasnost
in der Sowjetunion. In: Das Parlament. Heft 16/91
Runge, I. 1993: Vom
Kommen und Bleiben. Berlin
Saathoff,G./Schlegel,S.1993 Beratungsleitfaden NS-Verfolgung. Köln
Sacks, J.: 1992:
Wohlstand und Armut. In: Zedaka - Jüdische Sozialarbeit im Wandel.
Frankfurt/M.
Sallen, H. 1977: Zum
Antisemitismus in der Bundesrepublik Deutschland. Frankfurt/M.
Sartre, J.-P. 1994:
Überlegungen zur Judenfrage. Reinbek
Schäfer,B./Six,B. 1978:
Sozialpsychologie des Vorurteils. Kohlhammer
Schiedermair, R. et al
1986-1994: Handbuch des Ausländerrechts. Neuwied
Schmelz, U.O. et al
(Hg.) 1983: Studies in Jewish Demography. Survey for 1972-1980. New York
Schoeps, J. (Hg.)1992:
Neues Lexikon des Judentums. Gütersloh/München
Schoeps, J.(Hg.) 1993:
Das Deutschlandbild jüdischer Einwanderer aus der GUS. Duisburg/Potsdam
Senatsverwaltung f.
Soziales 1995: Top Berlin international. Nr.5/1995. Berlin
Silbermann, A. 1982:
Sind wir Antisemiten? Köln
Statistisches Landesamt
1994: Statistisches Jahrbuch. Berlin
Stern, F. 1991: Am
Anfang war Auschwitz. Tel Aviv/Gerlingen
tageszeitung (taz ) -
Protest gegen Antisemitismus. 12.2.1990
- Russischer Antisemitismus heute. 24.4.1990
- Entsetzen über Einwanderung nach Deutschland. 3.1.1991
- Die neue Völkerwanderung. taz-Sonderausgabe. 8.6.1991
- Morddrohung gegen Juden. 2.9.92
- Chronologie über Antisemitismus in Deutschland 1992. 30.1.1993
- Wer regiert Rußland? Die Mafia! (Autor: Kerneck,B.) 16.6.1994
Tajfel, H. 1982:
Gruppenkonflikt und Vorurteil. Bern, Stuttgart, Wien
Tölke, A. 1987:
Historische Ausgangssituation und Veränderung im Ausbildungs- und
Erwerbsverhalten junger Frauen in der Nachkriegszeit. In: Voges,W. (Hg.).
Methoden der Biographie-und Lebenslaufforschung. Opladen
Treibel, A. 1990:
Migration in modernen Gesellschaften. Weinheim/München
Troen, I. 1993: Die
Perspektive eines Israeli. In: Bade,K./Troen,I. (Hg.): Zuwanderung und
Eingliederung von Deutschen und Juden aus der früheren Sowjetunion in
Deutschland und Israel, S.26-36, Bonn
Tyrangiel, S. u.a.
1989: Die Kinder der Verfolgten. Göttingen
Vetter, M. 1992: Juden
und Antisemitismus in Rußland 1900 bis 1990. (Austellungskatalog). Frankfurt
Wagner, M. 1989:
Räumliche Mobilität im Lebensverlauf. Stuttgart
Wiehn, E. (Hg.) 1987:
Juden in der Soziologie. Konstanz
Zentralwohlfahrtsstelle
der Juden in Deutschland (ZWST) 1950 - 1996: Mitgliederstatistik der
Jüdischen Gemeinden. Frankfurt
ZWST 1995: Leitfaden
für jüdische Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion. Frankfurt
Anmerkungen:
(108)
Von den 2.020 in
Berlin geborenen Gemeindemitgliedern sind 665 Personen vor 1945 geboren,
1.178 Personen zwischen 1945 und 1989 und 177 Personen seit 1990. Von
letzteren haben 110 Kinder Eltern, die aus der ehemaligen Sowjetunion
stammen.
(109)
Eine Abweichung
zu den anderen Bundesländern betrifft die unter 2.2 erwähnte kleinere
Einwanderungsbewegung sowjetischer Juden in den 70/80er Jahren, die
ausschließlich nach Berlin kamen (soweit bekannt ca. 2.500 Personen).
(110)
Der
Ausländeranteil (gemessen an der Staatsbürgerschaft) läßt sich nicht genau
feststellen. Der Geburtsort allein kann nicht als Indikator gelten: Ein Teil
der Mitglieder verfügt über die deutsche (und u.U. auch noch eine zweite)
Staatsbürgerschaft – seit Geburt, erworben durch Daueraufenthalt oder
Wiedereinbürgerung. Umgekehrt sind viele der in Deutschland geborenen
Mitglieder nicht deutsche Staatsbürger und ein recht hoher Anteil älterer
Personen mit langjähriger Aufenthaltsdauer ist weiterhin staatenlos. Schmelz
gibt für die 70er Jahre einen Anteil von 35,7 % Ausländer ("aliens") in der
jüdischen Population der BRD an (1983,S.84). Trotz einiger
zwischenzeitlicher Einbürgerungen, eingedenk der niedrigen Fertilität der
ansässigen Juden und der starken GUS-Immigration dürfte sich diese Zahl bis
heute auf weit über 50 % erhöht haben. (Damit ist die häufige Zuschreibung
"Jude = Ausländer", die in anderen Kontexten zu monieren wäre, statistisch
gesehen sogar berechtigt.)
(111)
Die jüdische
Nachkriegsgeneration ist i.d.R. mehrsprachig aufgewachsen, gut ausgebildet
und in allen Berufssparten vertreten; oft auch in selbständigen Berufen.
Ausgenommen die neuen GUS-Migranten, ist die Arbeitslosenquote relativ
niedrig (gemessen am Anteil der Gemeindesteuer-Zahler und ddf Klientel der
Gemeinde-Sozialabteilungen).
(112)
Wie erwähnt, ist
das Diaspora-Judentum generell durch Überalterung und geringe Geburtsraten
geprägt. Stellt man z.B. Wiener und Berliner Juden gegenüber, ergibt sich
ein ähnliches Bild: In Wien teilte sich in den 70er Jahren - bei
gleichbleibendem Trend bis heute - die jüdische Bevölkerung in drei große
Altersgruppen auf, von der fast die Hälfte über 60jährige waren, mehr als _
zur mittleren Generation gehörten (41 - 60jährige) und knapp _ die Gruppe
der unter 40jährigen ausmachten (vgl. Schmelz 1993,S.78f).
(113)
Mitglieder aus
dem Migrantenkreis in den Neubundesländern (Nord/Süd) - Quelle:
ZWST-Statistik 1989-1996; eigene Berechnungen:
| |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
|
Norden / Personen |
unter 50 |
113 |
165 |
152 |
366 |
572 |
749 |
|
Süden / Personen |
unter 50 |
105 |
232 |
287 |
432 |
412 |
420 |
Während der Norden (Gemeinden Rostock, Schwerin,
Magdeburg, Potsdam) sukzessiv steigende Zahlen neuzugewanderter
Gemeinde-mitglieder aufzuweisen hat, ist die Zahl der Mitglieder im Süden
(Gemeinden Erfurt, Chemnitz, Leipzig, Dresden) zunächst gestiegen, stagniert
jedoch seit 1993, da es mehr Ab- als Zugänge gibt (insbesondere wegen der
stadtfernen Unterbringung der Zuwanderer).
(114)
Wachstumsrate lt.
ZWST-Statistik (1995):
| Alter
|
0-3 |
4-6 |
7-11 |
12-16 |
17-21 |
22-30 |
31-40 |
41-50 |
51-60 |
61-70 |
71-80 |
>80 |
|
Wachstum |
11% |
65% |
101% |
119% |
82% |
61% |
53% |
113% |
58% |
34% |
58% |
49% |
Die errechnete Rate bezieht sich auf das Wachstum zwischen
1989 (= 100%) und 1994.
(115)
Dazu Schmelz: "In all
the Jewish communities recently reserearched, fertility is lower than that
of the corresponding general population. [..] Mainly due to their prolonged
low fertility Diaspora populations have a very small percentage of children
but relatively high percentages of persons in the age brackets 46-64, 65 and
above" (1983, S.3f).
(116)
Die
Tora
- das Alte Testament -
bildet Gesetz und Grundlage des Judentums. Sie wurde und wird im
Talmud
unter Anerkennung
der Unvollkommenheit und ständigen Veränderungsbedürftigkeit der Welt
kommentiert und überdacht. Ihre Gesetze, die soziale, rechtliche und
psychische Belange vereinen und ihre Auslegung orientieren sich am
Einzelfall und dem Grundsatz: die Gebote sind gegeben, damit "der Mensch in
ihnen lebe und nicht, daß er an ihnen zugrunde gehe"(Joma 85b), vgl. "Einst
wird der Mensch Rechenschaft ablegen müssen, über jeden rechtmäßigen Genuß,
den er sich versagt hat (Gidduschim 4,12). Anders als in der christlichen
Erlösungsreligion mit ihrer auf das Jenseits bezogenen Weltsicht und einer
gewissen Gleichgültigkeit gegenüber "irdischen Zuständen" entspricht das
Verhältnis des Menschen zur Gemeinschaft, zum Mitmenschen im Judentum einer
"Ethik des Diesseits", die in zentralen sozialen Prinzipien festgeschrieben
ist: Neben
Mizwa
("Gebot"), der
Pflicht des Helfens sind dies
Zedaka
("Gerechtigkeit")
und die ihr übergeordneteG'miluth
Chassadim
("Barmherzigkeit"). Armut gilt nicht als gottgewollt, sondern als "Riß in
der Gerechtigkeit"; Wohltätigkeit ist somit Akt ausgleichender Gerechtigkeit
und impliziert ein Recht auf Hilfe (Hilfe zur Selbsthilfe gilt als höchste
Stufe der Wohltätigkeit). In der christlich geprägten Gesellschaft, in der
soziale Not lange "gottgewollt" bzw. das Individuum schuldig an seinem
"Versagen" war, kam die Anerkennung der "Machbarkeit der Verhältnisse", die
soziale Frage als Strukturfrage erst mit den negativen Auswirkungen von
Industrialisierung und kapitalistischem Wachstum in Leistungsansprüchen zum
Tragen (vgl. Flierl 1992).
(117)
Der Aufbau der
deutschen Einheitsgemeinden geht auf die preußisch-deutsche Gesetzgebung
zurück, die mit der Erhebung der Gemeinden aus der Sphäre des privaten in
die des öffentlichen Rechts im 18.Jahrhundert den Parochialzwang wieder
einführte und erst in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts Juden ermöglichte,
aus einer Gemeinde auszutreten, ohne damit auch aus dem Judentum
auszuscheiden. Daraufhin setzte eine Austritts- und Neugründungsbewegung
ein, in der viele eine Gefahr der Zersplitterung des Judentums sahen. Nach
1945 hielt man aufgrund der wenigen Überlebenden am Konzept der
Einheitsgemeinde fest (die orthodoxes, liberales und Reformjudentum unter
einem Dach vereinigt), aus der sich seit Ende der 80er Jahre jedoch einzelne
Gruppen abzuspalten beginnen.
(118)
Die Großgemeinden
verfügen über koschere Restaurants und Lebensmittelläden (Berlin, München,
Frankfurt), Alten- und Pflegeheime (10 Einrichtungen bundesweit), Jüdische
Kindergärten (in 9 Gemeinden), Grundschulen (Berlin, Frankfurt, München,
Düsseldorf), Jüdisches Gymnasium (Berlin), Erziehungsberatungsstellen
(Berlin, Frankfurt/M.), Jüdische Volkshochschulen (Berlin, München) sowie
Bibliotheken, Logen, Seniorenklubs, Frauen-, Wohltätigkeits- und
Ehrenamtlichenvereine und andere Selbsthilfeinitiativen und jüdische Gruppen
(vgl.auch ZWST 1995, S.7ff).
(119)
Die Jüdische Oberschule
unterscheidet sich von anderen Gymnasien durch die Unterrichtung in Fächern
der Judaistik (Hebräisch, Bibel- und Religionslehre), durch koscheres
Mittagessen und jüdische Rituale (B'rachot usw.). Für die Zuwanderer wird
daneben Deutsch-Förderunterricht und ein Schülerklub angeboten. 1994, zur
Eröffnung der Schule, entstammten 40 % der Schülerschaft dem sowjetischen
Zuwandererkreis; 2/3 aller Schüler gehörten der Jüdischen Gemeinde an, 35 %
hatten vorher die Jüdische Grundschule besucht. Von den 17 Lehrern waren 7
jüdischer Herkunft, davon 3 aus Israel, 2 aus der ehemaligen UdSSR (vgl.
Mull 1994).
(120)
Mit der Förderung
dieser Theaterarbeit konnte einer relativ großen Gruppe geholfen werden: das
erste "Zuwanderer-Theater" in der Bundesrepublik beschäftigt Schauspieler,
Sänger, Tänzer, Bühnenbildner, Regisseure, Kameraleute, Tontechniker,
Choreographen. Es spielte zunächst in russischer Sprache, begann dann mit
Märchenstücken u.a. in Berliner Schulen in deutscher Sprache zu spielen,
erhielt 1995 eine EU-Förderung für jiddische Stücke und arbeitet inzwischen
selbständig.
(121)
Dem Konzept des
Seniorenzentrums (getrenntes Appartement-Wohnhaus, Wohnheim und Pflegeheim
für chronisch Kranke) liegt die Idee zugrunde, den Bewohnern den Wechsel von
häuslicher in Heim-Umgebung zu erleichtern, ihnen die Möglichkeit zu geben,
sich in einem vertrauten und jüdischen Umfeld zunächst weiter selbst zu
versorgen, und später, wenn nötig, nahtlos das Seniorenheim mit
Vollbetreuung bzw. das Pflegeheim in Anspruch nehmen zu können. Derzeit ist
es zu etwa 70 % von Neuzuwanderern bewohnt.
(122)
Ein Interviewausschnitt zeigt, wie sich dies aus Sicht einer
alteingesessenen Mutter auswirkt: "Ich überlege mir ernsthaft, ob ich meine
Tochter in eine andere Schule gebe. [..] Das ist doch keine jüdische Schule
mehr, hat doch kein Niveau mehr. In der Klasse wird fast nur Russisch
gesprochen, sie kann inzwischen bald besser Russisch als Deutsch. Der
Unterricht tritt dafür auf der Stelle. [..] Ich bringe meinen Kinder bei,
daß wir kein Schweinefleisch essen und zum Kindergeburtstag gibt's das dann
bei den Russen."
hagalil.com
28-02-03
•
Synagogen
und Gottesdienste
•
Wichtige Adressen
•
Terminkalender
•
Führungen
•
Startseite
•
English Content |